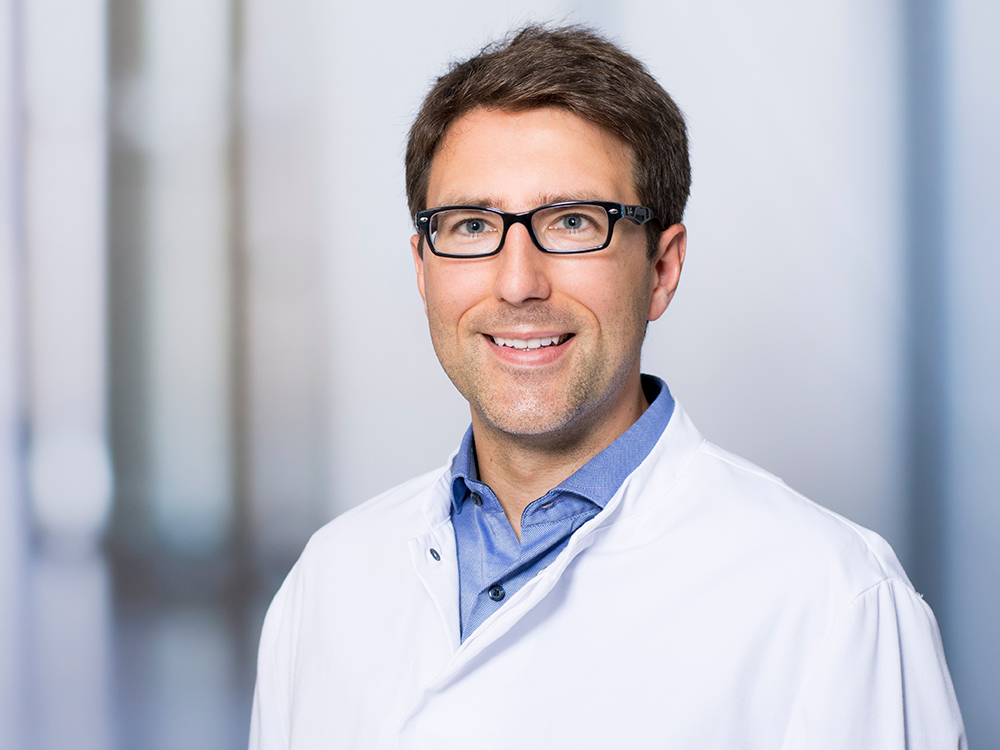„Ich sehe das positiv: Ich darf leben“
Nach 60 Tagen an der Lungenmaschine kämpft sich Ulrich Zecke im Weaning-Zentrum des Klinikums zurück in den Alltag
Seine Überlebenschancen lagen bei gerade einmal zehn Prozent, als er vom Klinikum Kaufbeuren ins Klinikum Ingolstadt verlegt wurde. Seine Lungen besaßen nur noch das Volumen eines Kleinkindes. Doch Ulrich Zecke hatte Glück: Es wurde gerade ein Platz an der künstlichen Lunge im Klinikum frei, und das Ärzteteam hat sich trotz schlechter Aussichten dafür entschieden, den Kampf um das Leben des 53-Jährigen aufzunehmen.

„Ich wage zu behaupten, dass ich woanders jetzt nicht mehr am Leben wäre“, sagt Ulrich Zecke fast vier Monate nach seiner Einlieferung im Klinikum. „Ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen, weil sich jemand bereit erklärt hat, etwas zu tun.“ Und das, obwohl es tatsächlich nicht gut um den Vater und Ehemann stand.
Ende November hatte er den positiven Corona-Test in der Hand und zunächst keine Symptome. Knapp eine Woche später ist er aufgewacht und hat plötzlich keine Luft mehr bekommen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn sofort ins nahegelegene Krankenhaus in Kaufbeuren, die Sauerstoffsättigung betrug da gerade noch 64 Prozent, normal wären zwischen 93 und 99 Prozent. Dann ging alles ganz schnell: Noch am selben Tag wurde in Kaufbeuren ein CT von der Lunge gemacht, er wurde beatmet, ins künstliche Koma gelegt und intubiert. „Aufgeweckt“ wurde er erst zwei Monate später wieder – im Klinikum Ingolstadt.
Die ECMO war seine Rettung
Von dem, was in dieser Zeit alles passiert ist, um das Leben des Patienten zu retten, habe er zum Glück nichts mitbekommen, sagt Zecke. Ganze 60 Tage lang war er an der künstlichen Lunge, der ECMO, angeschlossen. Hinter dem Kürzel verbirgt sich der englische Name für Extrakorporale Membranoxygenierung. Diese übernahm die Funktion der Lungen vollständig und sorgte dafür, dass das Blut außerhalb des eigenen Körpers mit Sauerstoff angereichert und dann wieder zurück in den Körper geleitet wurde. „Meine Lungen waren wohl flattrig wie Pergament, die konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gebrauchen“, weiß er von Erzählungen der Ärzte.
„Da gab es sehr, sehr viele Herausforderungen“, erinnert sich Prof. Dr. Lars Henning Schmidt, Direktor der Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Thorakale Onkologie. „Neben einem Luftröhrenschnitt und zahlreichen blutungsbedingten Not-Operationen musste der Kreislauf des Patienten medikamentös am Laufen gehalten werden und er bekam über 30 Blutkonserven.“
„Es war total irre“
„Ich hatte zwischenzeitlich mehr Blutplasma von anderen Menschen als Eigenblut“, erzählt Zecke. Mittlerweile, fast zwei Monate nachdem er aufgewacht ist, kann er gut darüber sprechen. Doch die ersten Tage nach dem Koma waren alles andere als leicht. „Ich wusste nicht, wo ich bin, ich sah nur Schläuche und habe Panik bekommen“, erinnert er sich. Auch fiel es ihm schwer zwischen den Träumen, die er während der Zeit im Koma hatte und der Realität zu unterscheiden. „Es war total irre: Ich habe von Erlebnissen aus der Vergangenheit geträumt, gemischt mit Fantasien. Im einen Moment war ich im Urlaub und habe Wein getrunken, im nächsten Moment hatte ich eine Reha-Maßnahme.“
Was ist ein Delir?
„Viele Patienten mit langen Krankheitsverläufen auf der Intensivstation leiden unter dem sogenannten Delir – einem Krankheitsbild, welches durch die Intensivtherapie, v.a. durch die vielen abschirmenden Medikamente und die für Patienten sehr fremde Umgebung ausgelöst werden kann. Patienten berichten dann über Halluzinationen und Unruhezustände.
Das Intensivteam ist geschult darauf, dieses Delir frühzeitig zu erkennen und dann umgehend Maßnahmen einzuleiten, die diesen Zustand schnell beenden oder abmildern. Dazu gehören unbedingt Familienbesuche und das Wiederherstellen eines Tag-Nacht-Rhythmus sowie das Erkennen und Behandeln von Schmerzen. Auch der persönliche Kontakt zwischen Pflegenden, ÄrztInnen und TherapeutInnen mit dem Patienten ist hier entscheidend, um in diesen Momenten Vertrauen aufzubauen und Sicherheit zu schaffen“, erklärt Prof. Martina Nowak-Machen, Direktorin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Palliativ- und Schmerzmedizin.
Einmal habe er wahrgenommen, dass seine Frau ihn besucht hat. „Das spürt man einfach“, sagt er. „Und der Tom, der war auch sehr präsent in meiner Wahrnehmung.“ Mit „Tom“ ist Thomas Kemmetter gemeint, der seit Tag eins fast täglich beim Patienten war, um die Atmung zu kontrollieren und die Maschinen richtig einzustellen. „Denn genauso wichtig wie die künstliche Beatmung ist auch die schrittweise Entwöhnung von der Beatmung“, erklärt der langjährige Intensivpfleger und Atmungstherapeut. Das sogenannte „Weaning“ beginnt bereits mit der Intubation und wird Schritt für Schritt ausgeweitet.

Zurück zum Atmen
Die Entwöhnung von der maschinellen Beatmung ist vor allem bei Patienten, die länger als 96 Stunden künstlich beatmet wurden, eine anspruchsvolle Aufgabe und läuft nach einem hochprofessionellen Prozess, dem sogenannten „Weaning“ ab, was im Deutschen mit „Entwöhnung“ übersetzt werden kann. Dabei bekommt der Patient zunächst eine sogenannte druckunterstützte Beatmung. Das heißt, der Betroffene steuert schon selbst, wann er atmet, wird aber bei jedem Atemzug von der Maschine unterstützt. Danach folgen spontane Atemversuche ohne maschinelle Unterstützung. Deren Dauer wird Schritt für Schritt – nach einem festgelegten Stufenplan – ausgedehnt, bis der Patient am Ende über 24 Stunden oder länger selbstständig atmen kann.
Dieser Prozess sei bei „normalen“ Beatmungspatienten bereits sehr komplex. „Das Weaning von Covid-19-Patienten ist allerdings nicht vergleichbar mit dem Standard-Entwöhnungsprozess“, sagt der Atmungstherapeut. „Die Lungen dieser Patienten sind teilweise schwer beschädigt, das Weaning ist zeit-und personalintensiver, aufwendiger und der Weg zur Genesung sehr viel länger als bei anderen Weaning-Patienten.“
Eine neue Idee schützt die Patienten in Bauchlage
Mittlerweile sind Therapeut und Patient beim Du. „Beim Ulrich wurden alle Maßnahmen ergriffen, die es nur gibt“, erzählt Kemmetter. „Sein Begleitschreiben ist so dick wie ein Buch.“ Darin wurden alle Behandlungsschritte, alle Werte, Eingriffe, Zustandsveränderungen und Zwischenfälle dokumentiert. Herr Zecke lag zweimal 48 Stunden auf dem Bauch. „Wissen Sie, wie Patienten normalerweise aussehen, nachdem sie 24 Stunden auf dem Bauch lagen?“, fragt Kemmetter. Die Gesichter seien übersät mit Druckstellen und angeschwollen. Die Schultern werden durch die einseitige Belastung oft verletzt. Bei Herrn Zecke sei das, trotz der extrem langen Liegedauer auf dem Bauch, nicht der Fall gewesen.
Das hat er einer neuen Entwicklung zu verdanken, die Thomas Kemmetter im Sommer vergangenen Jahres am Klinikum für Patienten, die lange Zeit auf dem Bauch positioniert werden, entwickelt und eingeführt hat. Dank einer Schaumstoffgesichtsschale werden die betroffenen Körperstellen in Gesicht und Schultern entlastet. Es entstehen kaum mehr Druckstellen. Seit Dezember ist dieses sogenannte Prone Positioning Board auch auf dem Markt erhältlich.

„Da fängt man an, wieder Mensch zu sein“
Mitte Februar, nach rund 2,5 Monaten an der Beatmungsmaschine, haben die eigenen Lungen von Ulrich Zecke wieder so gut funktioniert, dass er selbstständig atmen konnte. Dank Physiotherapie und Ergotherapie lernte er ab diesem Zeitpunkt kurze Wege mit dem Gehwagen zu laufen, selbstständig ins Badezimmer zu gehen und nach und nach auch wieder feste Nahrung zu sich zu nehmen. „Da fängt man an, wieder Mensch zu sein“, sagt der Mittfünfziger, der vor der Erkrankung mitten im Leben stand und in seinem Beruf viel Eigenverantwortung trug. „Plötzlich ist man auf dem Stand eines Babys, braucht für alles, wirklich alles, Unterstützung. Das war sehr belastend für mich.“
Doch er ist ein Kämpfer, wie er selbst sagt. „Ich wollte schon immer mindestens 80 Jahre alt werden, körperlich und geistig gesund. Und das nehme ich mir jetzt erst Recht vor.“ Und so steckt er sich täglich kleine Ziele, um jeden Tag ein Erfolgserlebnis zu haben. „So macht es mir Spaß“, sagt er. Auch seine Einstellung zum Leben habe sich seitdem geändert. „Das, was ich früher für ein Problem gehalten habe, war keins. Ich sehe das jetzt positiv: Ich darf leben.“
Ansprechpartner